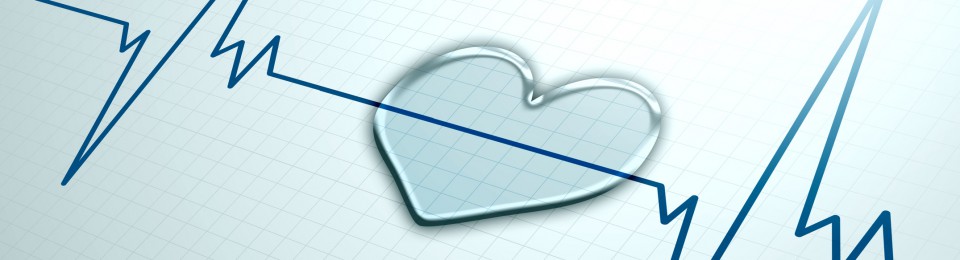Schlagwörter
Bürgerdialog, Bürgergipfel, intensivmedizin, Palliativ Care, palliativmedizin, Telemedizin, Telemonitoring
 Vergangenes Wochenende hat er stattgefunden – der Bürgergipfel, auf dem als Abschluss des Bürgerdialogs Zukunftstechnologien der Bürgerreport ausgearbeitet wurde.
Vergangenes Wochenende hat er stattgefunden – der Bürgergipfel, auf dem als Abschluss des Bürgerdialogs Zukunftstechnologien der Bürgerreport ausgearbeitet wurde.
Insgesamt 100 Bürger haben dort zusammengesessen und an konkreten Handlungsempfehlungen für die künftige Gesundheitsversorgung gearbeitet, die am Sonntag der Bundesforschungsministerin Annette Schavan im Paul-Löbe-Haus übergeben wurden.
Der Bürgerdialog ist Teil eines umfassenden Beteiligungsprozesses, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung für einen Zeitraum von vier Jahren zu verschiedenen Zukunftstechnologien initiiert hat. Dieser Bürgerdialog Zukunftstechnologien ist einer der größten Politikberatungsprojekte in der Geschichte der Bundesrepublik. Der erste Bürgerdialog widmete sich Energietechnologien für die Zukunft.
 Ich habe dieses Wochenende als sehr konstruktiv und produktiv wahrgenommen. Los ging es am Samstagmorgen um 9.30 Uhr. Zufällig ausgewählte Bürger, die auch schon an einer der Bürgerkonferenzen teilgenommen haben, wurden ins Paul-Löbe Haus eingeladen und haben dort mit Experten an runden Tischen die aufbereiteten Ergebnisse erneut unter die Lupe genommen und diskutiert.
Ich habe dieses Wochenende als sehr konstruktiv und produktiv wahrgenommen. Los ging es am Samstagmorgen um 9.30 Uhr. Zufällig ausgewählte Bürger, die auch schon an einer der Bürgerkonferenzen teilgenommen haben, wurden ins Paul-Löbe Haus eingeladen und haben dort mit Experten an runden Tischen die aufbereiteten Ergebnisse erneut unter die Lupe genommen und diskutiert.
Dabei ging es, wie schon desöfteren auf diesem Blog beschrieben um drei Themen:
- Neuronale Implantate
- Telemedizin/ Telemonitoring
- Intensiv- und Palliativmedizin
Neuronale Implantate
 Mit dem Thema Neuronale Implantate habe ich mich erst im Rahmen des Bürgerdialogs auseinandergesetzt. Ein sehr spannendes aber gleichzeitig kontrovers diskutiertes Thema.
Mit dem Thema Neuronale Implantate habe ich mich erst im Rahmen des Bürgerdialogs auseinandergesetzt. Ein sehr spannendes aber gleichzeitig kontrovers diskutiertes Thema.
Schon die heute gängigen neuronalen Implantate, wie das Cochlea-Implantat für Gehörlose, stellen verlorengegangene Körperfunktionen und Sinne wieder her. Manche Forscher sind optimistisch: In Zukunft wird nahezu jeder Sinn und jedes Körperglied funktionsfähig ersetzt werden können, wenn man nur intensiv genug forscht. (These des BMFB)
Einen sehr schönen Artikel zum Thema Neuronale Implantate hat eine Teilnehmerin des Online-Dialogs geschrieben.
Gebt mir einen USB Stick, ich muss mein Gehirn zwischen speichern…
geschrieben von CrankCook in Neuronale Implantate am 23. März 2011 – 8:33
Beim dem Begriff „Neuronale Implantate“ in Kombination mit „Zukunftstechnologie“ hat man das Gefühl, man bewegt sich in einen Science-Fiction Film. In dem Menschen über Verknüpfungspunkte am Kopf massenweise Daten speichern oder sich mit einer Schnittstelle ins Internet einloggen. Was ich glaube für einige affine Technikfreaks eine „schöne neue Welt“ ist. Aber bleiben wir bei den was es bewirken soll. Implantate und elektronische Verknüpfung von Mensch zur Maschine ist nur dann sinnvoll, wenn dadurch das Leben der Menschen wirkungsvoll in der Lebensqualität verbessert wird. Was heute schon der Herzschrittmacher macht, kann vielleicht in der Zukunft Neurodermitis im Keim ersticken. Nicht das jeder durch technisch Apps zu besseren Menschen gemacht wird oder in seinem Chemiehaushalt so stark eingegriffen wird, dass sich seine ganze Person, sein Charakter verändert, sondern an den Punkten, wo ein bestimmter gesundheitlicher Erfolg im Vordergrund steht. Denkbar sind auch Messinstrumente die eine Langzeituntersuchung ermöglichen, diese aber nicht das alltägliche Leben beeinträchtigen (eine 24-Stunden-EKG-Maschine ist nicht gerade ein lustiger Begleiter). Um die anderen Möglichkeiten aus der Welt der Science Fiction kümmert sich bei Gelegenheit die Unterhaltungsindustrie.
Das man sich hier aber auf ein nicht ungefährliches Spiel einlässt, sollte also jedem klar sein. Im Vordergrund steht die Leistungserhaltung bzw. –wiederherstellung, nicht die Leistungssteigerung – das wurde immer wieder kontrovers diskutiert.
Die Verlockung mag groß sein, sich als eine Art „Übermensch“, der sich neuronal dopt – auszurichten. Aber ist der menschliche Körper überhaupt dazu in der Lage, mit diesen Impulsen und diesen Reizen umzugehen? Und wer legt fest, was noch im Rahmen ist und was nicht. Schnell fallen mir Science Fiction Filme ein, in denen eine Art Mind Control stattfindet. Aber wollen wir uns das wirklich antun? Und wer wäre es, der darüber entscheidet.
Auch dazu wurden am Samstag und Sonntag Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung herausgearbeitet und in den Bürger-Report aufgenommen. Auch auf dieses Thema bezogen besteht noch erheblicher Diskussionsbedarf. So muss sich die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung zu Neuronalen Implantaten noch stärker an transparenten und gesellschaftlich getragenen Kriterien orientieren. Diese Kriterien wiederum müssen partizipativ entwickelt werden.
Schwerpunktsetzung, aufgrund begrenzter Forschungsmittel für ausgewählte Anwendungsmittel und Zielgruppen ist hier unumgänglich. Es gilt also gemeinsam herauszuarbeiten „Wo beginnt der Bedarf und wo beginnt der Anspruch auf neuronale Implantate? Wer benötigt Neuronale Implantate zuerst und besonders?“
Der Stellenwert des Bürgers an sich wurde immer wieder herausgehoben. Wunsch ist es, ihn und nicht die Krankheit stärker in den Mittelpunkt der Erforschung der Funktionsweise von Neuronalen Implantaten zu stellen. Feedback der Betroffenen soll berücksichtigt werden und intensiv und systematisch in eine international vernetzte Forschung einfließen. Meiner Meinung nach, ein extrem wichtiger Punkt.
Betrachtet man das ganze Thema nämlich international, so wird einem schnell klar, an wie viel verschiedenen Baustellen parallel gearbeitet wird und wie oft das Rad bereits zwei- oder mehrere Male erfunden wurde bzw. wird, und mit welchen entstehenden Kosten wir es dabei zu tun haben. Die Stärkung des Wirtschaftsstandort Deutschland vs. unnötiger Kosten, da schon vorhandene Technologien, gehört also sorgfältig ausgelotet und begründet.
Telemedizin
 Auf das Thema Telemedizin/ Tele Monitoring bin ich schon des Öfteren auf meinem Blog eingegangen. Ein Punkt, den ich bisher noch nicht so stark in den Vordergrund gestellt habe, betrifft das Thema „Neue Berufsbilder“ rund um Telematik. Wir werden es zukünftig mit einer Vielzahl neuer Berufsbilder zu tun haben. Dabei wird es zum einen viele Spezialisierungen geben, denkbar ist aber auch eine Art aufbauende Ausbildung, in der ähnlich wie das Nursing- und Medizinstudium in den USA Lehreinheiten parallel oder gemeinsam absolviert werden, auf einander aufgebaut wird und später eine Splittung erfolgt.
Auf das Thema Telemedizin/ Tele Monitoring bin ich schon des Öfteren auf meinem Blog eingegangen. Ein Punkt, den ich bisher noch nicht so stark in den Vordergrund gestellt habe, betrifft das Thema „Neue Berufsbilder“ rund um Telematik. Wir werden es zukünftig mit einer Vielzahl neuer Berufsbilder zu tun haben. Dabei wird es zum einen viele Spezialisierungen geben, denkbar ist aber auch eine Art aufbauende Ausbildung, in der ähnlich wie das Nursing- und Medizinstudium in den USA Lehreinheiten parallel oder gemeinsam absolviert werden, auf einander aufgebaut wird und später eine Splittung erfolgt.
Eigenverantwortlichkeit des Patienten stärken und das nicht nur bei der Gesundheitsprävention – der Patient muss nicht nur informiert, geschult und begleitet werden, nein er muss auch die Möglichkeit haben, sich selbständig damit auseinanderzusetzen. Um dies zu gewährleisten, wurden insgesamt drei Handlungsempfehlungen ausgearbeitet.
Datenschutz
 Auch hier kam das Thema Datenschutz, welches ich mitbearbeitet habe, zum Tragen. Datenschutz, IT-Security und Privatsphäre spielen gerade in der Telemedizin/ Telematik eine große Rolle. Niemand möchte zum gläsernen Patienten werden und seine Daten überall einsehbar hinterlegt haben. Auch gegen Hackerangriffe muss sich ausreichend geschützt werden. Mithilfe von Spionage-Software ist es möglich einen großen Lausch- und Spähangriff zu ermöglich und die Kontrolle über infiltrierte Computer zu übernehmen. Wer hat schon Interesse, dass der Nachbar, die Freunde oder gar der Arbeitgeber Einblick in die krankengeschichte und gesundheitsbezogene Daten bekommt. Durch Spionagesoftware wäre es rein theoretisch auch möglich, Einblick in die telemdizinische Sprechstunde zu bekommen. Etwas was sich furchtbar anhört und unbedingt vermieden werden sollte.
Auch hier kam das Thema Datenschutz, welches ich mitbearbeitet habe, zum Tragen. Datenschutz, IT-Security und Privatsphäre spielen gerade in der Telemedizin/ Telematik eine große Rolle. Niemand möchte zum gläsernen Patienten werden und seine Daten überall einsehbar hinterlegt haben. Auch gegen Hackerangriffe muss sich ausreichend geschützt werden. Mithilfe von Spionage-Software ist es möglich einen großen Lausch- und Spähangriff zu ermöglich und die Kontrolle über infiltrierte Computer zu übernehmen. Wer hat schon Interesse, dass der Nachbar, die Freunde oder gar der Arbeitgeber Einblick in die krankengeschichte und gesundheitsbezogene Daten bekommt. Durch Spionagesoftware wäre es rein theoretisch auch möglich, Einblick in die telemdizinische Sprechstunde zu bekommen. Etwas was sich furchtbar anhört und unbedingt vermieden werden sollte.
Datenspeicherung
 Auch ist in Planung, dass gesundheitsbezogene Daten an Forschungseinrichtungen weitergegeben werden. Dies lässt sich technisch gesehen vielleicht sogar relativ einfach bewerkstelligen, aber rechtlich gestaltet sich die Geschichte wesentlich komplizierter.
Auch ist in Planung, dass gesundheitsbezogene Daten an Forschungseinrichtungen weitergegeben werden. Dies lässt sich technisch gesehen vielleicht sogar relativ einfach bewerkstelligen, aber rechtlich gestaltet sich die Geschichte wesentlich komplizierter.
Das vom Bundesverfassungsgericht aus den Grundrechten auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 I GG) und auf Schutz der Menschenwürde (Art. 1 I GG) abgeleitete Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird verstanden als die „Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden“[2]. Dieses Recht schützt generell vor staatlicher Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten.[3]
Allerdings können Gesundheitsinformationen als eine der „besonderen Arten personenbezogener Daten“ im Sinne des § 3 IX BDSG nicht schon allein auf Grund eines Vertragsverhältnisses z. B. des Behandlungsvertrages erhoben und verarbeitet werden, wie dies sonst für nicht-öffentliche Stellen zur Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke gilt, § 28 I Nr. BDSG. Vielmehr ist dies von Notfällen abgesehen – prinzipiell nur dann zulässig, wenn der Patient unter ausdrücklichem Bezug auf die Gesundheitsdaten eingewilligt hat und zwar in schriftlicher Form, § 28 VI in Verbindung mit § 4 a I, III BDSG.
 Das geschieht durch die Heranziehung der Geheimhaltungspflichten in der zitierten Bestimmung des § 28 VII BDSG. Ärzte unterliegen der strafrechtlich durch § 203 I Nr. 1 StGB sanktionierten Geheimhaltungspflicht, wenn ihnen in ihrer Eigenschaft als Arzt „ein fremdes Geheimnis anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist“. So wenig anheimelnd der strafrechtliche Hintergrund der ärztlichen Verschwiegenheitspflichtlicht auch ist, so genau wird doch hier an das alles entscheidende Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient angeknüpft. Damit ist auch nicht so einfach, gesundheitsbezogene Daten einfach mal an ein Forschungsunternehmen oder aber Pharmaunternehmen weiterzugeben, die daran interessiert sind – evidencebasierend zu forschen.
Das geschieht durch die Heranziehung der Geheimhaltungspflichten in der zitierten Bestimmung des § 28 VII BDSG. Ärzte unterliegen der strafrechtlich durch § 203 I Nr. 1 StGB sanktionierten Geheimhaltungspflicht, wenn ihnen in ihrer Eigenschaft als Arzt „ein fremdes Geheimnis anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist“. So wenig anheimelnd der strafrechtliche Hintergrund der ärztlichen Verschwiegenheitspflichtlicht auch ist, so genau wird doch hier an das alles entscheidende Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient angeknüpft. Damit ist auch nicht so einfach, gesundheitsbezogene Daten einfach mal an ein Forschungsunternehmen oder aber Pharmaunternehmen weiterzugeben, die daran interessiert sind – evidencebasierend zu forschen.
Abhilfe können ein verschärfter Datenschutz und Richtlinien für die IT-Sicherheit geben, die selbstverständlich auch umgesetzt werden müssen. Sicherheits- und Datenmanagement werden also einen noch höheren Stellenwert bekommen. Der VDE hat zum Schutz von Patientendaten ein Sicherheits- und Qualitätsmanagement-System für die Telemedizin erarbeitet. Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut zeichnet damit Telemedizin-Zentren nach den harmonisierten Normen DIN EN ISO 9001 aus. Der VDE-Standard stellt sicher, dass Patientendaten nicht unautorisiert an Dritte weitergegeben werden. Bei einer konsequenten Anwendung ist somit ein Missbrauch von Patientendaten nahezu ausgeschlossen.[4]
Intensiv- und Palliativmedizin
Interessant war, dass im Falle der Intensiv- und Palliativmedizin aus Sicht der Bürger die Arbeitsbedingungen im Vordergrund standen. Wunsch ist es, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern, Bewährtes erhalten bleibt und Neues gestaltet werden soll. Die Wertschätzung soll gesteigert werden.
Sicherlich ein Punkt, der bei allen Beteiligten der medizinischen und pflegerischen Versorgung beteiligt sind, auf offene Ohren stößt. Für mich sehr positiv, wenn man bedenkt, dass die Teilnehmer des Bürgergipfels einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen und nicht nur Angehörige der Gesundheitsberufe vertreten waren. Chancen der neuen Technologien werden in der zeitlichen Entlastung des Personals, um mehr auf die sozialen Bedürfnisse der Patienten eingehen zu können. Die Technisierung der Medizin wirft aber auch Fragen zur Berücksichtigung der Menschenwürde auf. Auf keinen Fall soll der menschliche Kontakt in den Hintergrund rücken.
Grundsatz der Palliativpflege ist die „Wahrung der Würde und die Autonomie des Gepflegten über dessen Tod hinaus, die Akzeptanz des Sterbens und der Tod als Teil des Lebens […] sowie die Anwendung des Grundsatzes „so viel wie nötig, sowenig wie möglich (High Touch-low Tech) – der insbesondere die Überversorgung und die Einschränkung der Lebensqualität durch pflegerische und medizinische Maßnahmen verhindern soll.
Prinzipiell wird im Palliativ-Care-Ansatz weder versucht das Leben künstlich zu verlängern noch zu verkürzen. Von daher gehört auch hier der Einsatz der neuen Technologien besonders hinterfragt und medizinisch und ethisch durchleuchtet. Ziel ist es nicht, menschliche Krankheit und Leiden zu verlängern, sondern zu lindern.
Auch der dritte Bürgerdialog des BMBF wird sich mit einem zentralen Zukunftsthema beschäftigen. Wie Schavan erläuterte, wird im Mittelpunkt die Frage stehen: Wie können wir den Konsum in einer Wohlstandsgesellschaft nachhaltig gestalten, damit Menschen in anderen Erdteilen und künftige Generationen gut leben können? Der Dialog leiste damit einen wichtigen Beitrag zum Wissenschaftsjahr 2012, das unter dem Motto „Zukunftsprojekt Erde“ steht.
[1] BVerfGE 65, 1 (41 f.)
[2] BVerfGE 65, 1 (41 f.)
[3] Vgl. BVerfGE 78, 77 (84); dazu Murswiek, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz- Kommentar, 3. Aufl . 2003, Art. 2 Rn. 73. Typisches aktuelles Gefährdungspotential für die informationelle Selbstbestimmung bergen z.B. Methoden vorbeugender Rasterfahndungen; dazu Horn, DÖV 2003, 746 ff